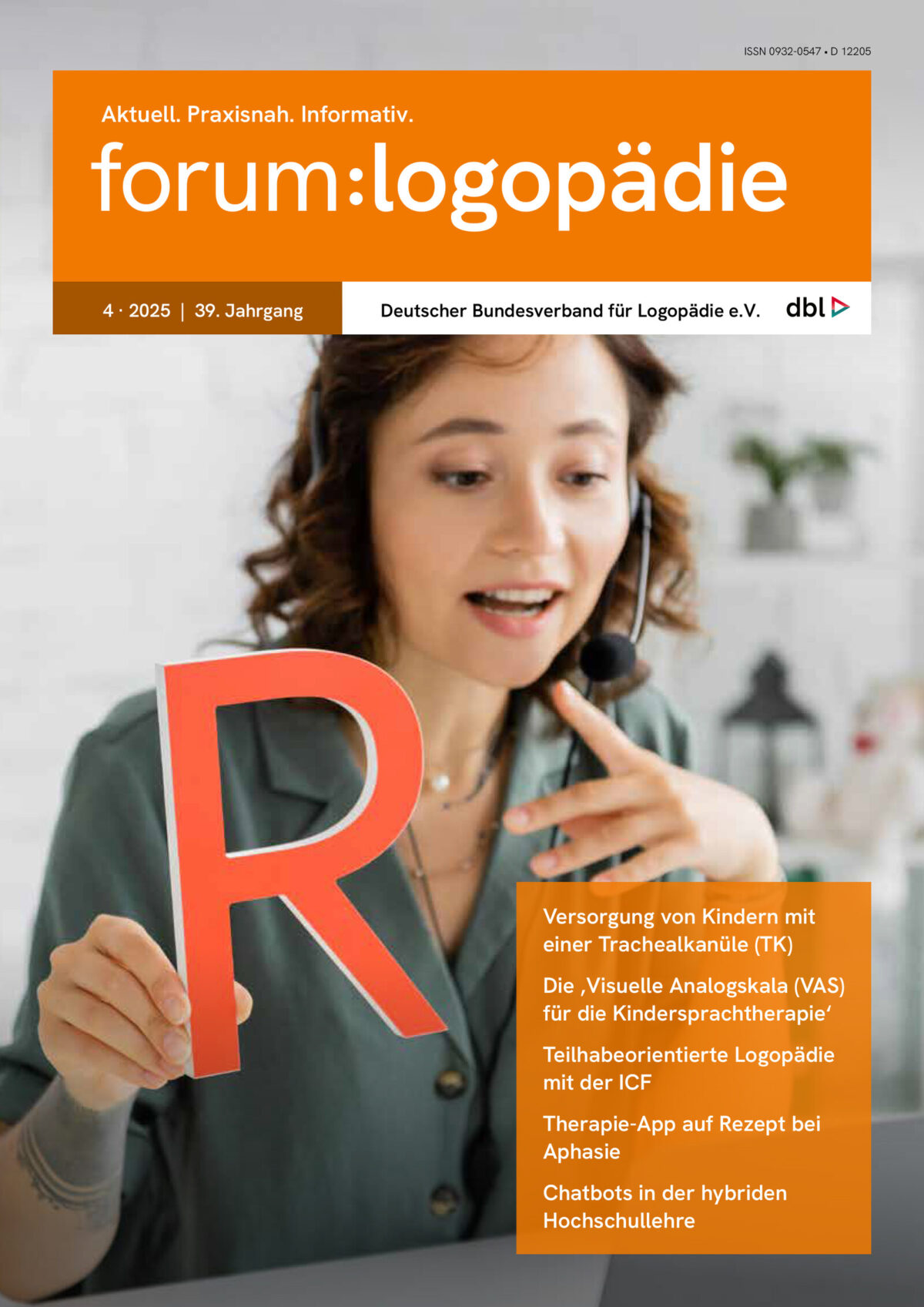Die BSV berät
Ein Gespräch mit Prof. Dr. rer. nat. Stefan Heim über wissenschaftliche Neugier, interdisziplinäre Zusammenarbeit und den Weg zur Forschungskultur in der Logopädie.

Die Logopädie befindet sich in einer spannenden Phase: vom rein praxisorientierten Heilberuf zur wissenschaftlich fundierten Disziplin. Ein zentraler Treiber dieser Entwicklung ist die Akademisierung – und mit ihr die Öffnung zur Forschung. Prof. Stefan Heim, Leiter der Logopädie-Studiengänge ander Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen (RWTH Aachen), bringt beides zusammen: Er ist Psychologe mit dem Schwerpunkt Neurowissenschaften und seit 20 Jahren in Lehre und Forschung der Logopädie aktiv. Zudem hat er internationale Erfahrungen durch einen Forschungsaufenthalt an der University of Pennsylvania sowie eine zweijährige Professur in Bergen (Norwegen) machen können. Im Gespräch mit ihm wird deutlich, wie fruchtbar das Zusammenspiel von Theorie und Praxis sein kann – und warum genau darin die Zukunft des Berufs liegt.

Vom Psychologiestudium zur Sprachtherapie
Sein Weg begann mit dem Studium der Psychologie in Bonn und einer Diplomarbeit am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig zum Thema Sprachproduktion. Die funktionelle Hirnbildgebung wurde früh zum roten Faden seiner Karriere – von der Promotion bis hin zum Forschungszentrum Jülich. Durch seine Tätigkeit an der RWTH Aachen, wo er seit 2005 im Bereich Lehr- und Forschungslogopädie lehrt, entwickelte sich dann ein enger Bezug zur Logopädie. „Mich hat schon immer interessiert, wie man mit kognitiven Modellen Menschen helfen kann – das findet sich sowohl in der Psychologie als auch in der Logopädie wieder.“
Forschung mit Relevanz für die Praxis
Seine aktuellen Forschungsprojekte drehen sich um Sprach- und Kommunikationsstörungen im Erwachsenenalter, insbesondere im Zusammenhang mit Demenz oder psychiatrischen Erkrankungen wie Schizophrenie. Gerade hier sieht er eine große Lücke: „Diese Bereiche stehen oft nicht im Fokus der logopädischen Arbeit – dabei sind die kommunikativen Auswirkungen auf die soziale Teilhabe enorm.“ Gleichzeitig interessiert ihn das Konzept der „Hirnreserve“, also wie Mehrsprachigkeit neuroprotektiv wirken kann. Forschung, so Stefan Heim, könne sehr konkret in der Praxis helfen – etwa bei der Differenzierung von Dyslexie-Profilen oder in der genaueren Diagnostik.
Akademisierung als Chance
Ein zentrales Thema ist für ihn die Akademisierung der Logopädie. Während sie in vielen europäischen Ländern längst abgeschlossen ist, steht Deutschland noch am Anfang. Hier ist die Logopädie bisher vorrangig ein Ausbildungsberuf, eine vollständige Akademisierung als primäre Qualifikation steht noch aus. Dabei haben klinisch forschende Logopäd*innen im internationalen Vergleich ein höheres wissenschaftliches Standing und sind besser in akademische Strukturen eingebunden.
Um die Forschung in der Logopädie weiter zu stärken, brauche es noch mehr internationale Anbindung, eine noch stärkere Verankerung forschenden Denkens im Studium und langfristig ein eigenes Fachkollegium innerhalb der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), so Stefan Heim. Zudem fehle es an unbefristeten Forschungsstellen und oft auch an struktureller Unterstützung. Dennoch sehe er Fortschritte, etwa durch internationale Kooperationen von Hochschulen, internationale Summer Schools oder durch Masterprojekte, in denen Studierende forschend arbeiten. Wichtig sei vor allem, „die Begeisterung für wissenschaftliches Denken“ zu fördern – nicht durch trockene Statistikseminare, sondern praxisnahe Fragestellungen und Einzelfallbeobachtungen, die neugierig machen.
Warum Forschung für die Praxis zählt
Häufig hört man in der Praxis den Satz: Ich brauche keine Forschung – ich sehe ja, was hilft. Für Stefan Heim ist das ein Trugschluss. Forschung sei kein Widerspruch zur praktischen Arbeit, sondern ihre Ergänzung: Wer dokumentiert, reflektiert und systematisch auswertet, könne aus jedem Fall lernen – das sei der erste Schritt zu evidenzbasierter Praxis. Forschung sei kein Selbstzweck, sondern ermögliche nachhaltige und effektive Therapie mit und für Patient*innen. Man könne nicht alles selbst erleben – dafür brauche es Teamarbeit und eine forschende Haltung, denn: „So kann man für die eigene Arbeit von den Ergebnissen der Kolleg*innen profitieren.“
Eine neue Generation von Logopäd*innen
Was wünscht sich Stefan Heim von angehenden Kolleg*innen? „Neugier! Geht auf Kongresse, stellt eure Erfahrungen vor, diskutiert, stellt Fragen.“ Forschung beginne oft mit dem persönlichen Interesse an einem Thema. Gleichzeitig betont er die Bedeutung von Professuren und Promotionen aus dem eigenen Fach heraus – als Vorbilder und Impulsgeber.
Ausblick: Forschung sichtbar machen
Am Ende des Gesprächs wagt Stefan Heim einen Ausblick: „Ich wünsche mir, dass wir in Zukunft genau sehen können, wie sich das Gehirn durch Therapie verändert – fast in Echtzeit.“ Dafür braucht es die finanziellen Mittel sowie langfristige Studien – und vor allem: eine forschungsfreudige Berufsgruppe. Die Logopädie, sagt er, sei bunt, vielfältig und voller Potenzial. Jetzt sei der richtige Zeitpunkt, dieses Potenzial wissenschaftlich sichtbar zu machen.
Für die BSV Nina Hildebrandt und Marietheres Pscheidt
Abonnenten lesen mehr
Als Abonnent lesen Sie diesen und alle anderen Online-Artikel und haben Zugang zu unserem großen Archiv.
Sie sind bereits Abonnent? Loggen Sie sich hier ein
Ganze Ausgabe als ePaper
Abonnenten haben vollen Zugriff auf alle Inhalte.
Werden Sie Abonnent
Erhalten Sie uneingeschränkten Vollzugriff auf alle Online-Inhalte und das große Archiv.